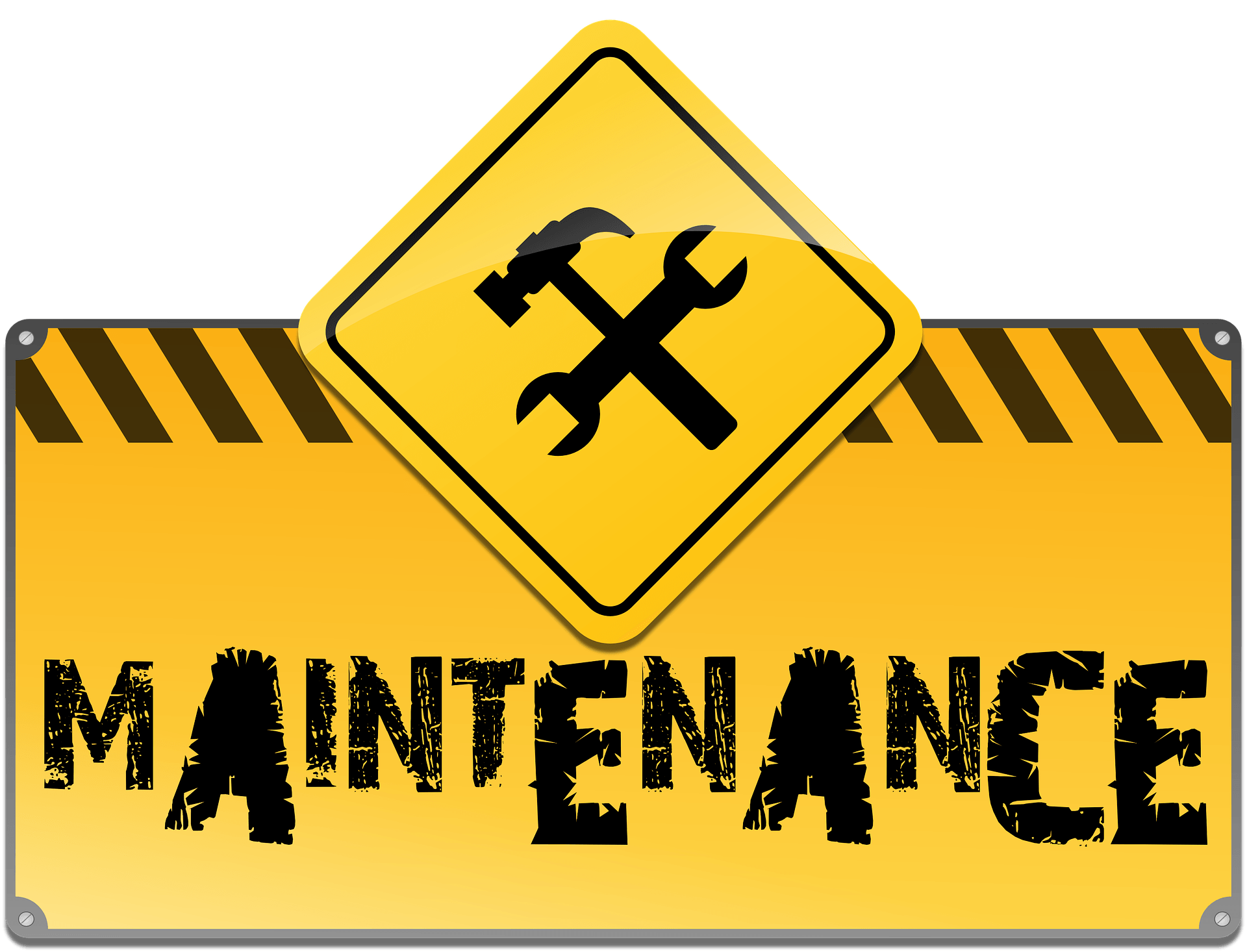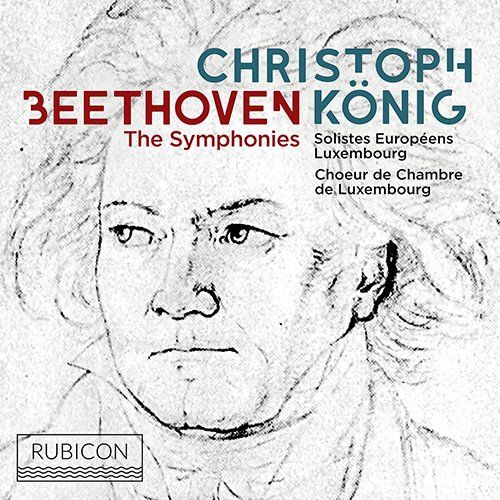INTERVIEW: “WIR BRAUCHEN DEN VERGLEICH MIT EINEM GUSTAV MAHLER CHAMBER ORCHESTRA NICHT ZU SCHEUEN!”
Ein Gespräch mit Christoph König, Chefdirigent der ‘ Solistes Européens Luxembourg ‘
Remy Franck pizzicato 12/2011

“Wir brauchen den Vergleich mit einem Gustav Mahler Chamber Orchestra nicht zu scheuen!”
Der deutsche Dirigent Christoph König ist seit September 2010 Chefdirigent der Solistes Européens Luxembourg . In Porto ist er Musikdirektor des dortigen Symphonieorchesters. Auf der Karriereleiter geht er den Weg, den die großen alten Dirigenten gingen, nichts überstürzend, aber zielstrebig. Remy Franck hat sich mit Christoph König unterhalten, der am 12. Dezember in der Philharmonie Bach und Sallinen dirigiert.
Christoph Königs gibt es viele, Ärzte, Diplompädagogen, einen Eishockeyspieler und sogar einen Jazzmusiker. Wollten Sie eigentlich immer nur Dirigent werden?
Ja, und zwar schon relativ früh. Schon als ich im Chor sang, haben mich die Chorleiter fasziniert. Es war die Tatsache, dass man als Dirigent bestimmte Klänge und Stimmungen erreichen kann und auch die Kommunikation dazu, die mich schon mit neun Jahren den Entschluss fassen ließen, Dirigent zu werden.
Sie haben Gesang und Klavier studiert. Hat das Chorsingen im Dresdner Kreuzchor heute für sie als Dirigent noch eine Bedeutung?
Ja, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Heute noch, wenn ich aufwache, teste ich meine Stimme. Und der erste Gedanke, wenn ich vor ein Orchester trete, ist der nach der sängerischen Phrase.
Wie begann das überhaupt mit der Musik?
Meine Mutter war Soloflötistin in Leipzig und hat, als ich geboren wurde, mit dem Beruf vorübergehend aufgehört zugunsten der Familie. Ich bin durch meine Eltern sehr zeitig in Kontakt mit Musik gewesen. Es war also ein natürlicher Prozess. Ich habe mit sechs angefangen, Klavier zu spielen und mit acht hat man entdeckt, dass ich eine schöne Stimme hatte. Ich wurde dann Mitglied im Kreuzchor.
Als Dirigent haben Sie u.a. bei Colin Davis und Sergiu Celibidache gelernt, also bei zwei sehr gegensätzlichen Figuren.
Ich traf Davis als Repetitor an der Semper-Oper in Dresden und habe dort für ihn assistiert. Zu Celibidache bin ich gereist, weil ich das einmal erleben wollte. Beide haben für mich eine große Rolle gespielt, wobei die Zusammenarbeit mit Davis sehr fruchtbar war und der Kurs bei Celibidache sehr unbefriedigend. Ich hatte den Eindruck, dass sich Celi für uns nicht wirklich interessierte und sich sehr um sich selber drehte. Das war etwas frustrierend. Davis hat mir mehr gegeben, ich habe bei ihm gelernt, wie flexibel und geschmeidig man mit einem Orchester arbeiten kann.
Davis hat viel Oper gemacht, Sie wenig.
Ich habe früher viel Oper gemacht. Dass ich heute weniger in der Oper bin, ist aus der Engagement-Situation heraus zu erklären, und ich bedauere das nicht, weil man zumindest im deutschsprachigen Raum als Dirigent in der Oper so viele Kompromisse eingehen muss, dass ich mich im Symphonischen sehr wohl fühle.
Wenn man Sie dirigieren sieht, stellt man fest, dass Sie manchmal den Taktstock benutzen und dann wieder nicht. Haben Sie das so gelernt? Ist das eine Methode?
Nein, das habe ich nicht gelernt. Ich habe selber damit experimentiert, wie es ist, wenn man ganz ohne Taktstock dirigiert und ich habe mich damit ziemlich wohl gefühlt, weil ich gemerkt habe, dass meine rechte Hand nicht so steif bleibt, wie wenn sie die ganze Zeit den Taktstock festhält. Später habe ich gemerkt, dass der Taktstock doch behilflich ist, zum Beispiel, wenn man Gesten vergrößern möchte. Und mir ist aufgefallen, dass ich ohne Taktstock besser modellieren kann, und mich dem Orchester sogar näher spüre als mit Taktstock, gerade in langsamen Sätzen oder bei einer Musik, die sehr weich ist, wo das Organisatorische eine weniger wichtige Rolle spielt. Ich habe aber keinen Plan. Mit oder ohne ist abhängig vom Moment, wie ich es gerade fühle.
Sie machen eine Karriere, wie man sie machen sollte. Sie haben an kleinen Häusern als Kapellmeister begonnen und sich dann langsam hoch gearbeitet, so wie es die großen alten Dirigenten zu tun pflegten. Haben Sie das bewusst so gemacht?
Nein, das ist eher ein Zufall. Aber es hat mir viel genutzt. Ich hätte auch Assistent bei einem Symphonieorchester werden können, aber das ist keine so fundierte Entwicklung. In der Oper kann man als Kapellmeister durchaus mitbekommen, wie etwas schief geht und wie man lernt, zu reagieren. Als Assistent bei einem großen Symphonieorchester erlebt man so was nicht wirklich. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich ganz bewusst am Anfang Repetitor werden wollte. Das war eine klare Entscheidung. Ich hielt das für sehr wichtig. Dass der Sprung in die Symphonik dann so gut geklappt hat, dafür bin ich sehr dankbar. Denn das war immer mein Wunsch: ein Symphonieorchester zu dirigieren.
Auch zu dem Zeitpunkt, als Sie im Dresdner Salonorchester spielten?
Mein Gott, woher wissen Sie das denn? Aber ja, ich habe in meiner Studentenzeit als Barpianist Geld verdient, ich habe auch ein Trio und ein Quartett gehabt und Tanztee in den Hotels gespielt. Und dann haben wir dieses Salonorchester gegründet. Ich war Frontmann am Mikrophon. Ich habe das sehr genossen.
Das war ja keine Klassik. Es gibt heute die Tendenz, die Klassik mit nichtklassischer Musik und nichtklassischen Künstlern zu verbinden. Wie stehen Sie dazu?
Es wäre für klassische Musiker oftmals von ungeheurem Vorteil, wenn sie die ganze Salonmusik kennen und spielen würden. Die Wiener Philharmoniker haben auch – und das war früher nicht der Fall – Johann Strauss akzeptiert und spielen seine Musik mit einer Qualität und einem Raffinement, wie es wirklich nur dieses Orchester tut. Und sie spielen so, weil sie Strauss ernst nehmen. Es gibt viele Musiker im klassischen Bereich, die nicht wirklich gut sind, aber die Nase unglaublich hochhalten gegenüber dieser Art von Unterhaltungsmusik. Das halte ich für völlig verfehlt und auch für einfallslos. Ich habe viel in dieser Richtung gemacht, teils, weil ich Geld verdienen musste, teils, weil mir dieser Musik auch gut gefallen hat. Auch das rhythmische Element von Jazz und Swing ist wichtig. Aber das hat für mich nichts mit der Frage zu tun, ob ich Crossover im klassischen Konzert machen möchte oder nicht. Die Frage stellt sich für mich eigentlich nicht. Ich würde schon gerne mit einem Symphonieorchester ein ganzes Sinatra-Programm machen. Aber das wäre dann keine Vermischung, sondern ganz klar das, was es ist. Ich denke, dass das Crossover vorwiegend durch Schallplattenfirmen entstanden ist, die merkten, dass ihnen die Märkte wegbrachen und sie mit diesen Methoden wieder Geld verdienen konnten. Das ist, ehrlich gesagt, nicht mein Geschmack. Ich würde nie sagen: Das ist unmöglich. Aber mich interessiert es nicht.

In Europa reisen Sie von oben nach unten, in Übersee nach China, Brasilien und in die USA. Haben Sie nicht manchmal den Eindruck, dass man Sie in diesem Musikbusiness laufen lässt, wie die weiße Maus im Radkäfig?
In meinem Beruf, wo oft schon ganz junge Dirigenten von ihren Agenten in eine andere Galaxie geschickt werden, durch irgendeinen Hype, der im Markt entsteht und nicht immer mit Qualität zusammenhängt, und andere Kollegen gar nichts zu tun haben, kann ich nur dankbar sein, dass ich viele Konzerte habe und meine Erfahrungen sammeln kann. Ich bin immer sehr neugierig gewesen. Und je mehr ich reise, umso mehr kann ich meine Neugier befriedigen. Ich spreche sieben Sprachen und kann in vielen Ländern mit den Leuten in ihrer Landessprache kommunizieren. So lerne ich die Menschen besser kennen. Das Rad ist also für mich eher ein Glücksrad. Aber ich muss natürlich auch lernen, auszuwählen und wie ich es machen kann, auch mal Nein zu sagen.
Sie sind also sehr international. Sehen Sie sich dennoch als typisch deutschen Dirigenten?
Ich identifiziere zwei Dinge mit deutsch: Beharrlichkeit und Verbindlichkeit. Das ist mir extrem wichtig. Es darf nicht beliebig werden. Klanglich interessiert mich nicht die teutonische Härte.
…aber eine deutsche Wärme.
Die interessiert mich sehr! Es wird sehr viel darüber palavert, oft ohne Ahnung. Der deutsche Orchesterklang ist für mich repräsentiert durch die Sächsische Staatskapelle Dresden, aber dort gibt es auch eine Leichtigkeit und eine Weichheit in den Streichern, die man nicht unbedingt mit dem Begriff deutsch in Verbindung bringt. Die Sächsische Staatskapelle ist nicht die kräftige deutsche Eiche, die sich nie biegt, sondern etwas sehr Flexibles. Also richtig definieren, was ein deutscher Klang ist, das kann ich nicht.
Sie haben neben Ihrem Posten als Chefdirigent der Solistes Européens Luxembourg den des Musikdirektors in Porto. Das ist, nach allem, was man liest und hört, eine Arbeit, die Sie begeistert.
Sie begeistert mich, hat mir aber auch viel Ärger gebracht. Man kann als Dirigent gut leben, ohne sich um Dinge zu kümmern, um die man sich lieber nicht kümmert. Als man mich in Porto als Chefdirigent angefragt hat, habe ich dreimal abgelehnt. Danach habe ich es mir dann doch überlegt und gemeint, ich sollte diese Verantwortung übernehmen. Ich war überzeugt, in Porto viel bewegen zu können, weil die aus diversen Gründen verlorengegangene Qualität augrund eines starken Potenzials zu steigern war.
Und finanziell ist das Orchester immer noch gut ausgestattet, trotz Krise?
Wir haben ein externes Budget für Auslandreisen bekommen und machen innerhalb von zwei Jahren vier Tourneen. Das ist ein großes Glück. Und für den Normalbetrieb gibt es Rücklagen, so dass man finanzielle Einschränkungen, die zur Zeit nötig sind, quasi überspielt.
Was hat sich bei den Solistes Européens verändert seit Ihrem Debüt?
Man glaubt immer, ein neuer Dirigent müsse Revolutionen begründen. Und man sagt mir, das Orchester habe sich in der letzten Zeit viel verändert. Ich persönlich glaube, dass sich in der Qualität des Orchesters nicht viel verändert hat, weil die schon zuvor auf einem sehr hohen Niveau war. Was sich verändert hat, ist der Umgang miteinander. Wir sind doch mittlerweile sehr, sehr entspannt. Der Ablauf der Proben ist von einer derart lockeren und fast schon undiszipliniert entspannten Professionalität, wie es nur in den besten Läden vorkommt. Wie diese Musiker aufeinander hören, aufeinander reagieren, das ist Top-Niveau. Besser geht’s nicht!
Welche Stellung haben die Solistes Européens Ihrer Meinung nach im Luxemburger Musikleben?
Wir machen ein Angebot, das es in der Form hier sonst nicht gibt. Wir sind ein kammersymphonisches Ensemble, das Beethoven- und Brahms- Symphonien in der Größe spielt, wie es zur Zeit der Uraufführung der Fall war, und füllen damit eine Nische. Ich halte uns für eine sehr schöne, mitunter vielleicht etwas exotische Farbe in einem mittlerweile sehr reich gewordenen Musikleben. Was ich gerne erreichen würde, ist dass die SEL auch international den Namen erarbeiten können, der ihnen zusteht. Wir brauchen den Vergleich mit einem ‘Gustav Mahler Chamber Orchestra’ wirklich nicht zu scheuen!
Sie sagen: in der Größe, wie sie bei den Uraufführungen üblich war. Damit verbindet man dann den Gedanken an die historische Aufrührungspraxis. Sie spielen auf modernen Instrumenten. Versuchen Sie trotzdem, Profit zu ziehen aus den Erkenntnissen, die jene gewonnen haben, die mit historischem Instrumentarium spielen?
Ja! Diese Fragen interessieren mich sehr. Die ganze Artikulation, die Akzentuierungen, das Non-Vibrato. Wie kann man Non-Vibrato spielen, ohne, dass es klingt, als habe man das Vibrato ausgeschaltet, also wie ‘tote Maus’. Da sind wir noch beim Experimentieren. Aber wir wollen ganz gewiss nicht den Vergleich antreten mit den spezialisierten Ensembles. Das wollen wir nicht, das können wir nicht, und weil die Musiker so gut sind, müssen wir das auch nicht. Aber in der Artikulation z.B, kann man schon sehr viel bewegen, um das Spiel lebendiger zu machen, statt mit viel Vibrato lange Bögen zu spielen. Nun ist die Vibrato-Frage etwas, das sehr kontrovers besprochen wird. Norrington lässt kategorisch kein Vibrato zu und andere sagen, ein kontinuierliches Non-vibrato-Spiel habe es nie gegeben. Es gab mal eine Phase, da wurde gesagt, man solle so viele Eier essen wie möglich, dann gab es eine Zeit, in der die Erkenntnisse zum Tragen kamen, laut denen ein zu hoher Konsum an Eiern gesundheitsschädigend sei. Dann sollte man viel Salz essen, danach kam die Warnung: auf jeden Fall solle man mit dem Salz sparen. Mittlerweile heißt es wieder, das Salz sei nicht so schlimm. Wenn man genügend trinkt.
Also ist Non-Vibrato eine Modeerscheinung?
Sie haben mich vorhin gefragt, ob ich ein deutscher Dirigent sei. Vielleicht bin ich bin der Hinsicht ein deutscher Dirigent, dass ich glasklar begründbare Entscheidungen treffen möchte. Wenn Sie nicht alle 5 Milliarden Bücher dieser Welt gelesen haben, in der behandelt wird, was man darf und wie man soll etc., müssen Sie zugeben, dass Sie immer nur ein Teilwissen haben. In einigen alten Abhandlungen steht, zu viel Vibrato sei geschmacklos. In anderen Büchern ist die Rede vom Vibrato zur Unterstützung der Klangschönheit. Wie viel gemacht wurde, kann heute keiner nachweisen. Man kann also nur schätzen. Das ist nicht wissenschaftlich, und weil es nie wissenschaftlichren nachzuweisen ist, werden immer unterschiedliche Meinungen dazu bestehen bleiben. Ich glaube, es hängt nicht von 5 Gramm mehr oder weniger Vibrato ab, sondern wichtig sind die Kommunikation, der Musikfluss, das Lebendige an der Musik, das was uns bewegt. Man kann heute unmöglich so spielen wie damals. Und das ist auch nicht relevant. Wenn Sie heute Mahler oder auch Gershwin so spielen, wie die selber gespielt haben, würden ihnen die Zuhörer weglaufen. Die haben fast rubatofrei gespielt, sie haben es richtig durchgezogen, ohne die ganzen Rubati und Verzögerungen und Akzentuierungen, die wir heute machen. Das heißt: die Art der Musikausübung ist eher eine Zeitfrage als eine historische Frage. Mich interessiert an der historischen Geschichte nur, dass ich Dinge vermeiden möchte, die völlig idiotisch sind.
Ist das Repertoire, das Sie hier in Luxemburg machen, Ihr Lieblingsrepertoire, oder bevorzugen Sie andere Komponisten, die Sie nicht hier, sondern nur mit einem großen Symphonieorchester machen können?
Ich liebe Mahler und Bruckner, der mir extrem nahe liegt, nicht wegen des Bombastes, sondern wegen der innigen langsamen Sätze. Richard Strauss liebe ich auch sehr. Aber ich fühle in Luxemburg kein Defizit. Was ich hier nicht machen kann, mache ich ja anderswo. Doch wenn Sie mich nach dem fragen, was ich mit auf die einsame Insel nehmen würde, dann würde ich schon antworten, dass das die Beethoven-Symphonien sind.
2011-12 Pizzicato 218 2011 Dec- König-1
PIZZICATO 12-2012
More Posts